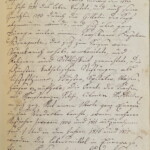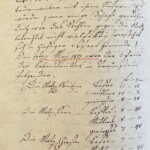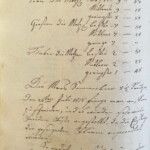Klimatische Anomalie, Hungersnot und regionale Überlieferung in der Pfarrchronik von Vachendorf
Das Jahr 1816 ist in die Klimageschichte als das sogenannte „Jahr ohne Sommer“ eingegangen – ein Begriff, der auf eine außergewöhnliche globale Kälteanomalie zurückgeht, die sich unmittelbar nach dem Ausbruch des Vulkans Tambora (Sumbawa, Indonesien) im April 1815 entwickelte. Das katastrophale Naturereignis gilt als der heftigste Vulkanausbruch der letzten 10.000 Jahre (VEI 7) und hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das globale Klima, die Landwirtschaft, die sozialen Strukturen und die kollektive Erinnerung in weiten Teilen der Welt – darunter auch im heutigen Südostbayern.
Der Ausbruch des Tambora (1815) und seine klimatischen Folgen
Am 10. und 11. April 1815 explodierte der Tambora mit einer geschätzten Eruptionskraft von mehr als 150 km³ ausgeworfenem Material. Die Explosion war in über 2.000 Kilometern Entfernung zu hören, und der Ausbruch tötete auf Sumbawa und den umliegenden Inseln direkt etwa 70.000 Menschen – überwiegend durch Pyroklastika, Tsunamis und Hungersnöte infolge der zerstörten Ernten.
Noch gravierender jedoch waren die indirekten Folgen für den gesamten Planeten: Die Eruption schleuderte bis zu 60 Millionen Tonnen Schwefelverbindungen (vor allem Schwefeldioxid) in die Stratosphäre, wo sie sich mit Wasserdampf zu Sulfataerosolen verbanden. Diese bildeten einen mehrere Monate lang beständigen Schleier in der oberen Atmosphäre, der weltweit die Sonneneinstrahlung erheblich reduzierte – insbesondere in der nördlichen Hemisphäre.
In der Folge kam es ab 1816 zu einem signifikanten Rückgang der mittleren Temperaturen um etwa 1–1,5 °C, mit regional deutlich stärkeren Abweichungen. Besonders betroffen war der mitteleuropäische Alpenraum, der ohnehin klimatisch sensibel auf äußere Einflüsse reagiert. Das Jahr 1816 fiel in eine bereits kühlere Phase der sogenannten Kleinen Eiszeit, was die Wirkung zusätzlich verstärkte.
Der Witterungsverlauf in Mitteleuropa – und im Chiemgau
In weiten Teilen Mitteleuropas – insbesondere in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und im Habsburgerreich – herrschten monatelang Regen, Kälte und Dunkelheit. Zeitgenössische Berichte sprechen von „nebelhaften“ Sommertagen, Schneefällen im Juli, dauerhafter Nässe und fehlender Reife bei Feldfrüchten.
Auch der Chiemgau blieb nicht verschont. Die klimatischen Verhältnisse in den Jahren 1816 und 1817 waren geprägt von:
• Spätfrösten im Mai
• Dauerregen im Juni und Juli
• Schneefällen im August, selbst in Tallagen
• einer komplett ausbleibenden Heu- und Getreideernte
• sowie verfaultem Obst und unreifem Gemüse.
Das wichtigste Grundnahrungsmittel der ländlichen Bevölkerung – der Hafer – blieb entweder im Wachstum stecken oder fiel der Nässe zum Opfer. Getreidepreise vervielfachten sich, das Vieh wurde notgeschlachtet, vielerorts fehlte es an Futter. Hungersnöte, Armut, Landflucht und teils auch Unruhen waren die Folge.
Die Vachendorfer Pfarrchronik als Quelle
Ein besonders aufschlussreiches Zeitzeugnis für diese Jahre stellt die handschriftlich geführte Pfarrchronik von Vachendorf dar. Verfasst wurde sie von Pfarrer Georg Hippelli, der die Pfarrei von 1803 bis 1831 leitete. In seinem Eintrag zum Jahr 1816 schildert er nicht nur den außergewöhnlichen Verlauf des Wetters, sondern auch die sozialen Auswirkungen der Krise in seinem unmittelbaren Umfeld.
Hippelli dokumentiert unter anderem:
• Preise für Lebensmittel (z. B. Mehl, Brot, Fleisch, Hafer)
• Maßeinheiten und deren Umrechnung
• Versorgungsengpässe, Notverkäufe und Tauschhandel
• Verarmung und Fluktuation in der Bevölkerung
• die subjektive Wahrnehmung der Krise
Sein Bericht ermöglicht somit nicht nur Einblicke in die Lebensrealität vor Ort, sondern liefert auch vergleichbare Daten für die historische Klimaforschung, Agrargeschichte und Sozialchronik. Die Sprache des Pfarrers ist nüchtern, präzise und dabei von tiefer Anteilnahme geprägt – eine seltene Kombination.
Dokumentation
Die nachfolgende Edition basiert auf dem Originaleintrag in der Vachendorfer Pfarrchronik und besteht aus zwei Teilen:
1. Bildstrecke des handschriftlichen Dokuments (deutsche Kurrentschrift), aufgenommen aus dem Archiv der Pfarrei Vachendorf
2. Zeilenweise, wortgetreue Transkription durch das Digitale Heimatarchiv, ohne Orthographieanpassung
Diese Form der Dokumentation erlaubt sowohl die wissenschaftliche Analyse als auch die niederschwellige Zugänglichkeit für interessierte Laien.
Quellen
• Oppenheimer, Clive (2003): Climatic, environmental and human consequences of the largest known historic eruption: Tambora volcano (Indonesia) 1815, in: Progress in Physical Geography 27(2), S. 230–259.
• Raible, Christoph C. et al. (2016): Tambora 1815 as a test case for high impact volcanic eruptions: Earth system effects, in: WIREs Climate Change 7, S. 569–589.
• Brönnimann, Stefan et al. (2019): The 1815 Tambora Eruption in Switzerland and Europe: A multi-disciplinary perspective, in: Geographica Helvetica 74(3), S. 235–247.
• Pfarrer Georg Hippelli: Pfarrchronik Vachendorf, handschriftliches Original (1803–1831), Archiv der Pfarrei Vachendorf.
• HISTALP-Datenbank: Historical Instrumental Climatological Surface Time Series of the Greater Alpine Region, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), Wien.
• Glaser, Rüdiger (2001): Klimageschichte Mitteleuropas. 1000 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen, Darmstadt.
Transkription des Textes ausklappen
§ IV
Die Theurung
Nach dem Kriege 1815, welcher im Jahr 1788,
in Paris mit Bestürmung der Bastille seinen
Anfang nahm, dem König Ludwig dem 16ten
im Jahr 1791 das Leben kostete, und auch
seiner Gemahlin 1793 durch die Gillotin der Kopf
abgenommen wurde, und sich über ganz
Europa unter einem Korsikaner Napoleon
Bonaparte, der sich zum Kaiser von
Frankreich erhobe, verbreitete und
Religion und Sittlichkeit zernichtete,
die schönsten katholischen Stiftungen, als
Bischofthümer, Klöster, Spitäler, Waisen-
häuser etc. aufhobe; die Ornate der Kirchen,
als Monstranzen, Kelche, Ciborien, Meßkleidung
an sich zog. Mit einem Worte ganz Europa
ins Verderben brachte; waren mehrere
Mißjahre wovon 1800 und 1811 auszunehmen
sind und in den Jahren 1816 und 1817
wurden die Lebensmittel in Europa so
theuer, als sie noch niemals gewesen waren.
Ich selbst hatte im Jahr 1816 so wenig Korn
bekommen, daß ich unter das Brod den 4 ten
Teil Gersten mischen ließe. Die Bauern
in der Pfarr Vachendorf behalfen sich
mit Haber Essen. Viele Dienstboten
hatten keine Dienste. Die Anzahl der
armen Bettler war sehr groß wie man
sich denken kann, sie baten nur um
Brod, 30 bis 40 kamen des Tages, selbst
Bauernweiber mit ihren Kindern. Es
wurden zwar einige Schafe gestohlen,
doch war das stehlen gegen die Noth
betrachtet nicht vielfälltig verstehet
sich in hiesiger Pfarr Gemeinde.
Den 19. May 1817 war der Preis
der Lebensmittel in Traunstein
folgender:
Die Metze Weizen. (in Gulden-Kreuzer fl-kr)
bester 11-10
mittlerer 10-2
geringster 8-20
Die Metze Korn
bester 8-40
mittlerer 8-3
geringster 9-40
Die Metze Gersten
bester 9–
mittlerer 6-45
geringster 5-10
Die Metze Haber
bester 3–
mittlerer 2-10
geringster 1-30
Maas Bier 6 Xr
2 Eyer 6 Xr
1 P. Schmalz 34 Xr
1 P. Rindfleisch 10 Xr
1 P. Kalbfl. 10 Xr
1 P. Schweines. 14 X
1 P. ?. 30 Xr
1 P. ? 28 Xr
1 P. Lein-Oel 28 Xr
Ich kaufte vom Becker zu Siegsdorf
ein roggen Brod Batzenleibl es wog
8 1/2 Loth, und kostete 4 Kreutzer
Ein Semmel um 1 Kreutzer wog 1/2 Loth
1 1/2 quintl
Den 28. Juni 1817 war der Getreidepreis
folgender:
Weitzen die Metze
bester 10-30
mittlerer 11-59
geringer 9-59
Korn die Metze
bestes 9-59
mittleres 8-49
geringes 8-49
Gersten die Metze
beste 7-12
mittlere 6-6
geringe 6-6
Haber die Metze
bester 2-46
mittlerer 2-20
geringer 1-30
Den 21ten Juni 1817 war der Getreidepreis
in Traunstein folgender:
Weitzen die Metzen
bester 15
mittlerer 14-21
geringer 11-30
Korn die Metze
bestes 9-50
mittleres 9-18
geringes 8-50
Gersten die Metze
beste 7-50
mittlere 7-20
geringe 7—
Haber die Metze
bester 2-50
mittlere 2-28
geringe 1-48
Die Maas Sommerbier 8 1/2 Kreutzer
Den 26. Julin 1817 fing man an, Korn
zu schneiden, und es wurden sehr viele
Freuden Feste angestellt, da die Erstlinge
der gesegneten Fluren eingeerndtet wurden.
So endete eine Theuerung der
Lebensmittel, welche noch niemals im
solchen Grade existiert hatte, wozu
aber die Getreidehändler mit dem
unerhörten Wucher das meiste beytrugen.
Hippelli