

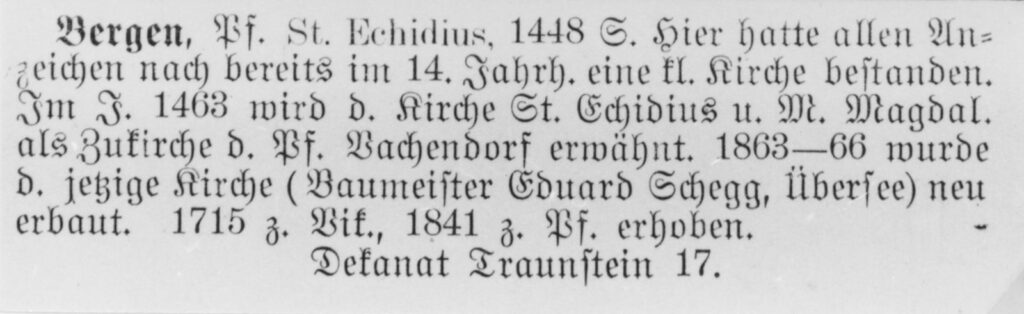
Wo der Kirchturm den Himmel kitzelt
Der Maxl ist vielleicht mit dem Radl gekommen. Von Bernhaupten her hat er ihn schon gesehen, den Turm so spitz, dass er ihm fast durch die Luft aus dem Radlreifen rausgestochen hätt’. „Des is koa Turm“, hat er gedacht, „des is a Zeigefinger Gottes!“ Da war ihm schon klar: Das wird gezeichnet.
Am Dorfplatz ist er dann runergestiegen von seinem Radl, hat seinen Zeichenblock beim Wirt deponiert und ist erstmal ein paar Schritte durchs Dorf spaziert. Bergen war schon damals kein stilles Eck, sondern ein Ort mit Schwung. Handwerk, ein Hauch von Kunst, gute Lage. Der Maxl hat sich gleich wohlgefühlt. Er ist ein bissl durch die Gassen gegangen „Do is was los, do bleibt ma“, hat er gesagt. Und dann ist er zur Kirche marschiert – zur St. Ägidius Kirch’.
Die Kirche von außen
Die Kirche steht mitten im Ort. Kein Schnickschnack außenrum – kein Hügel, kein Vorplatz mit Balustrade. Sie steht einfach da, klar, aufrecht, selbstbewusst. Und der Turm? Der hebt sich fast vom Rest ab, so schlank, so spitz, dass es einem fast schwindlig wird. Wer 1863 diesen Grundstein gelegt hat, der hat gewusst, was er will. Und 1869, als sie den Turm auf 59,15 Meter erhöht haben, da hat einer nochmal gesagt: „Weiter auffi! Dann san mir höher wia die Vachadorfer!”
Die Bauform ist spätklassizistisch, aber mit einem gewissen Blick für Wirkung. Kein Übermaß, keine protzige Pracht, sondern ein zurückhaltendes, fast bürgerliches Selbstverständnis. Und trotzdem strahlt die Kirche eine Würde aus, als wüsste sie ganz genau, dass man sie nicht übersieht. Man geht nicht vorbei, man schaut hin.
Die Kirche von innen
Drinnen wird’s still. Nicht schwer und überladen, sondern aufgeräumt und stimmig. Der Innenraum ist neugotisch gestaltet, mit feinen Spitzgewölben und harmonischer Gliederung. Wer reingeht, der merkt: Hier war ein Gespür für Raum. Kein Prunk, aber Haltung.
Der Taufstein aus Tegernseer Marmor stammt von 1866. Der Hochaltar wurde 1908 durch ein Steinrelief ersetzt – schlicht, aber mit Aussage. Die Seitenaltäre aus dem Jahr 1915 stammen von Ludwig Schnitzenbaumer, einem Münchner Historienmaler. Und wer genau hinschaut, sieht die Handschrift von Max Fürst, dem Traunsteiner Maler, der dem Kirchenraum Leben eingehaucht hat. Es ist eine stille Kunst, eine, die nicht schreit, sondern trägt.
In den 1970er-Jahren, bei der letzten großen Renovierung, wurde alles wieder in Einklang gebracht – unter Leitung von Vinzenz Dufter aus Siegsdorf. Klassizistische Architektur und nazarenische Ausmalung – zwei Welten, die in Bergen zusammengefunden haben.
Was sich der Maxl gedacht hat
Der Maxl hat sich in den Schatten neben die Kirche gesetzt. Er hat das Skizzenbuch aufgeklappt, den Bleistift gespitzt, und hat mit der Turmspitze angefangen. Das ist untypisch, aber in dem Fall war’s nötig – weil man sonst nicht wusste, wo man aufhören soll. Der Turm ging ihm fast über den Rand.
Und wie er so dasitzt, ist er ein bisschen müde geworden. Die Sonne war angenehm, das Dorf leise, der Kirchturm wie ein Metronom, das in den Himmel tickt. Da ist ihm fast ein bissl der Kopf auf die Brust gefallen, und in seinem Traum hat er gesehen, wie eine Seilbahn direkt von der Kirche rauf zum Hochfelln schwebt. Die Leute haben gelacht, haben dem Pfarrer beim Einsteigen geholfen, und oben gab’s Brotzeit für alle. „Na also“, hat er im Traum gemurmelt, „des nennt ma dann wohl Himmelfahrt.“
Als er wieder aufgewacht ist, war sein Zeichenblatt halb voll, und zwei Leute sind dagestanden. „Darf ma mal schauen?“ hat einer gefragt. Und der Maxl hat gesagt: „Na freili – aber ned lachen, is bloß der Entwurf.“
Dann haben sie sich zusammengesetzt – am Platz unten beim Brunnen. Es gab eine resche Brezn, a paar Radi, a kloans Stückl Bergkäse. Und natürlich a Halbe, frisch und goldgelb. Sie haben über Kunst geredet, über Linien, über Licht – und vielleicht auch über’s Leben.
Die Kirche steht immer noch – und der Maxl hätt’s sicher auch wieder zeichnet.